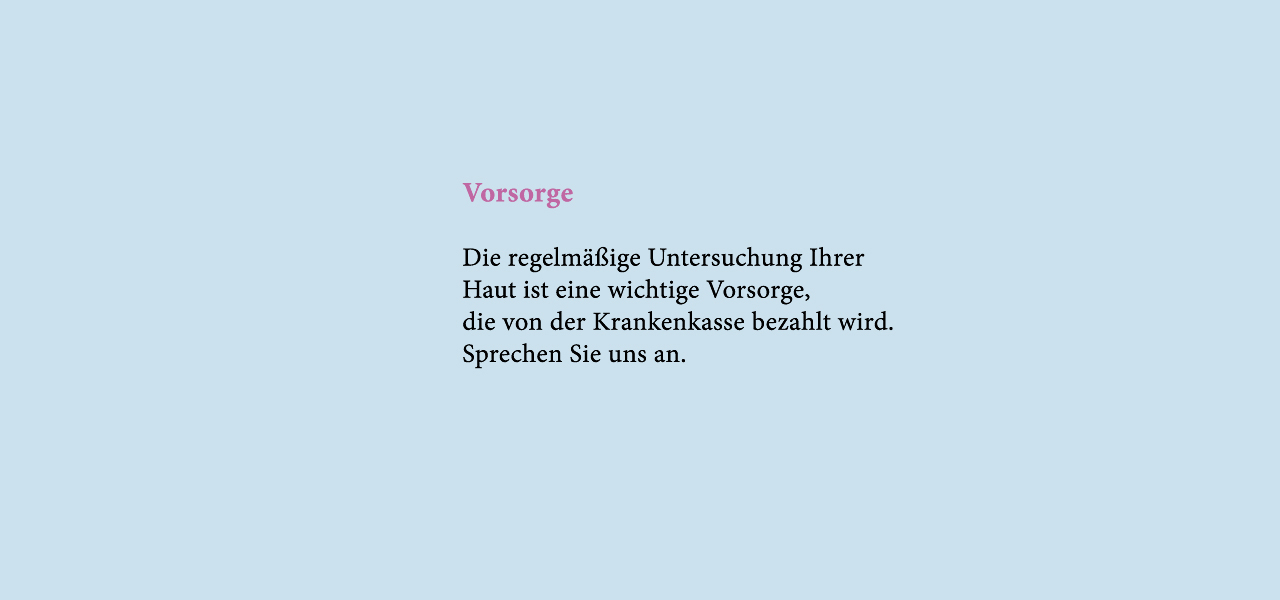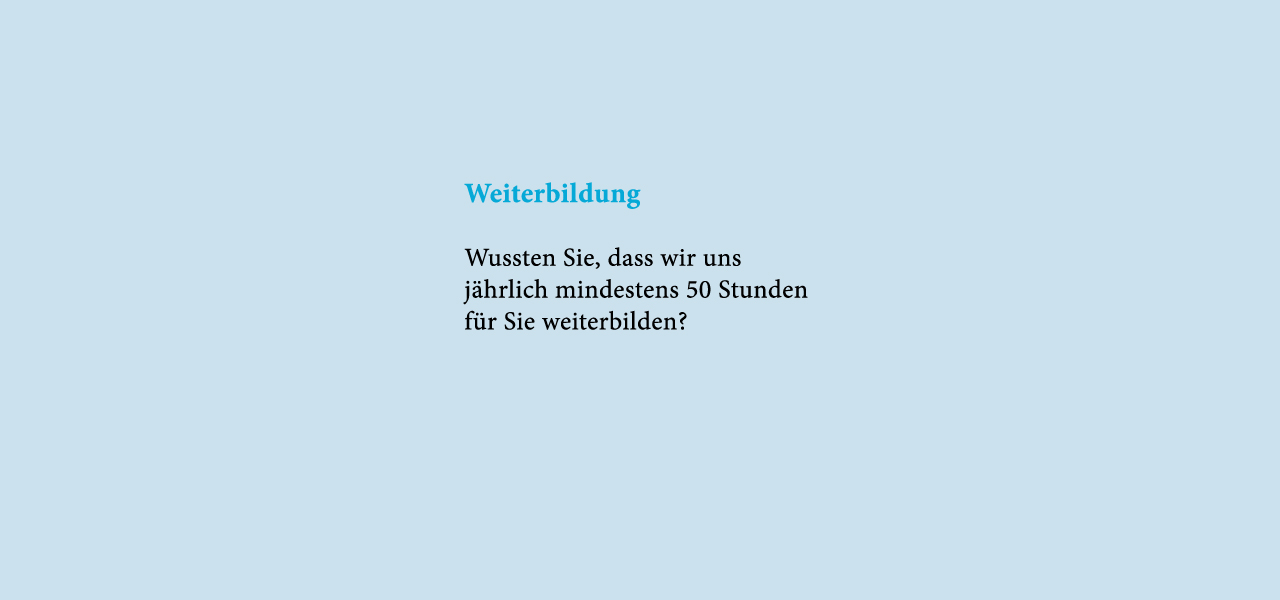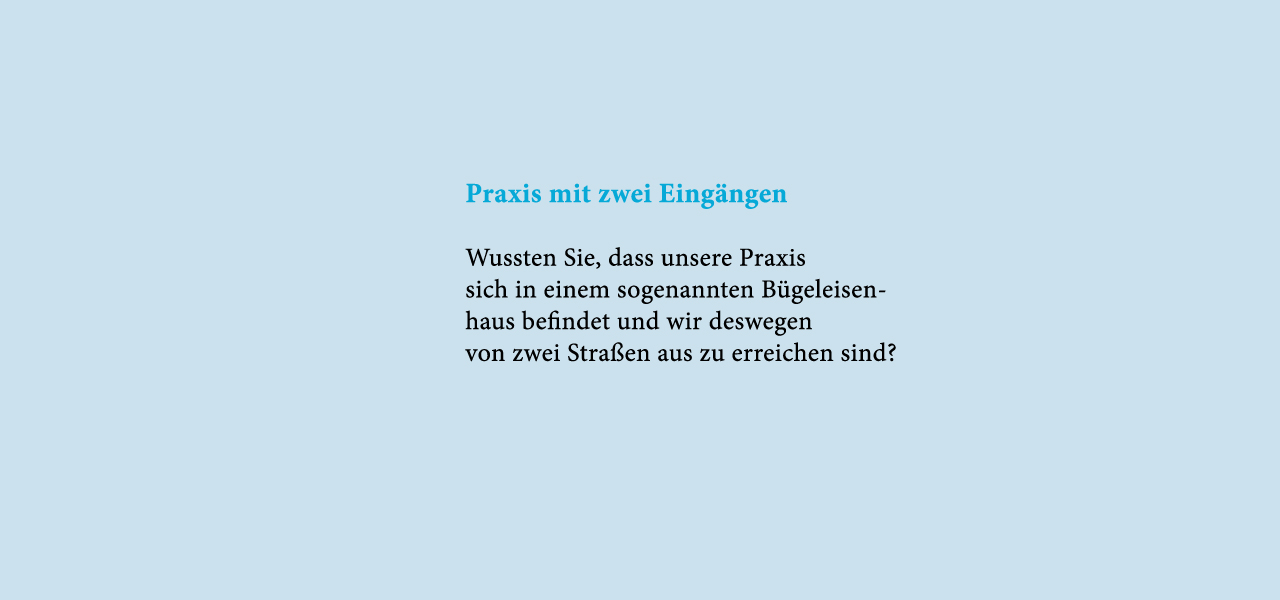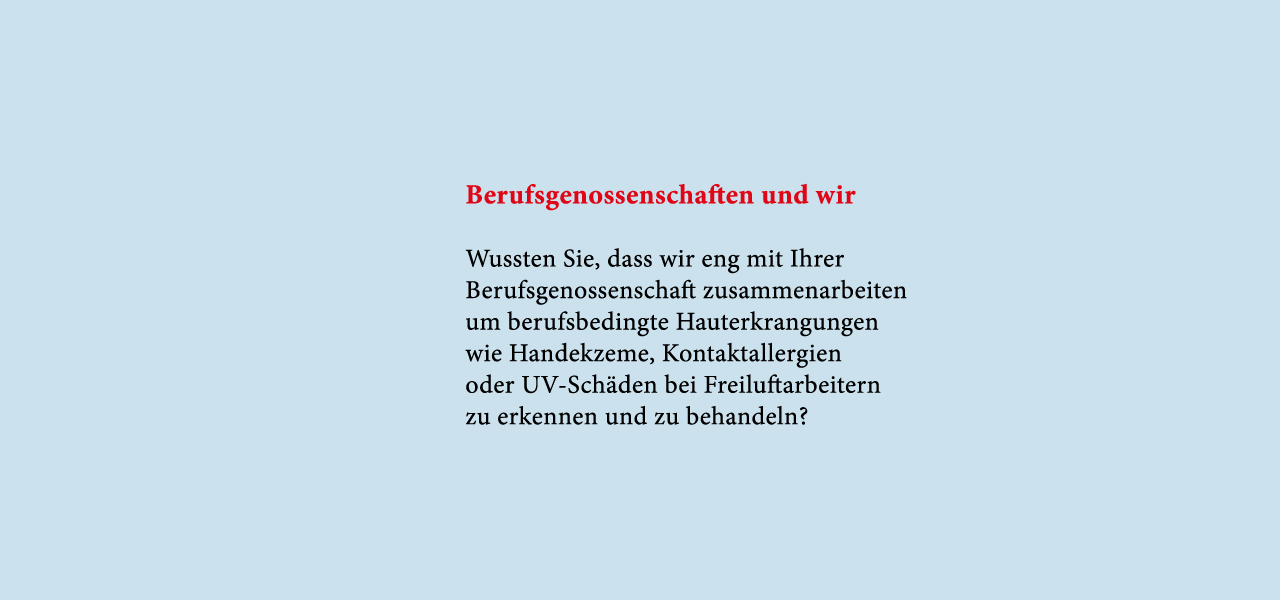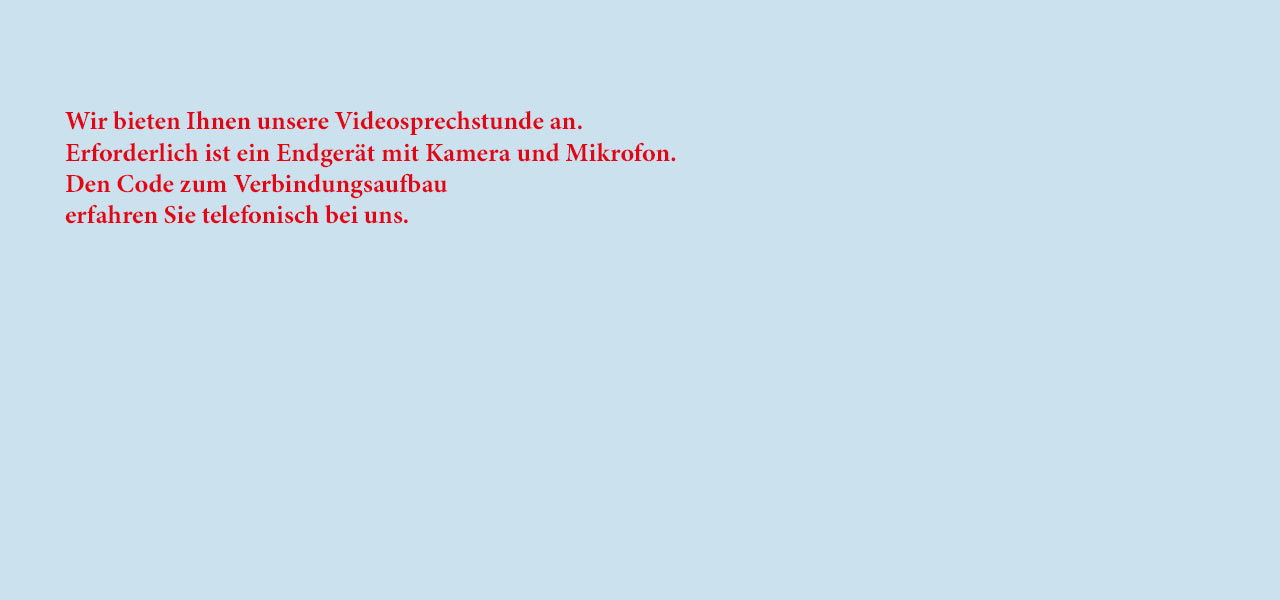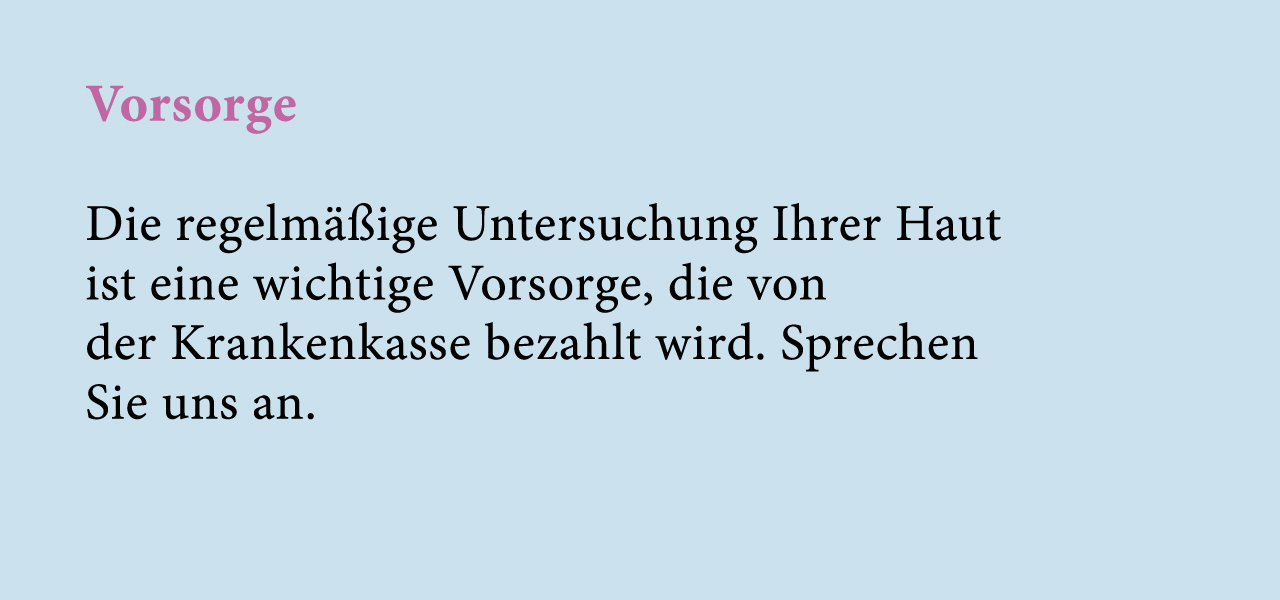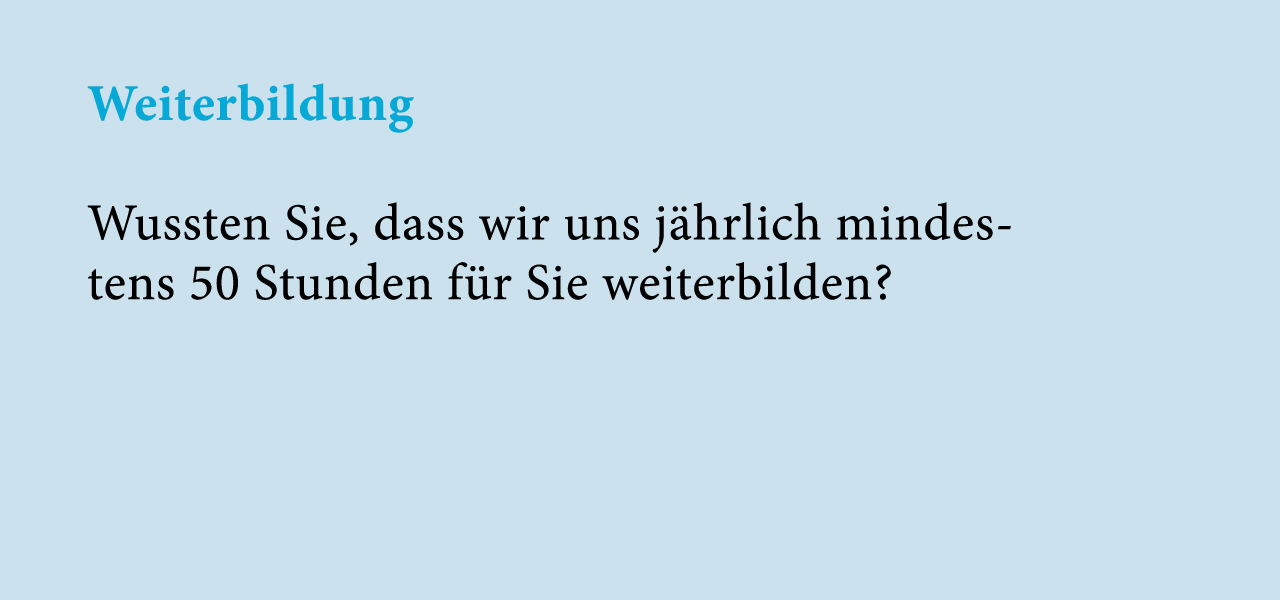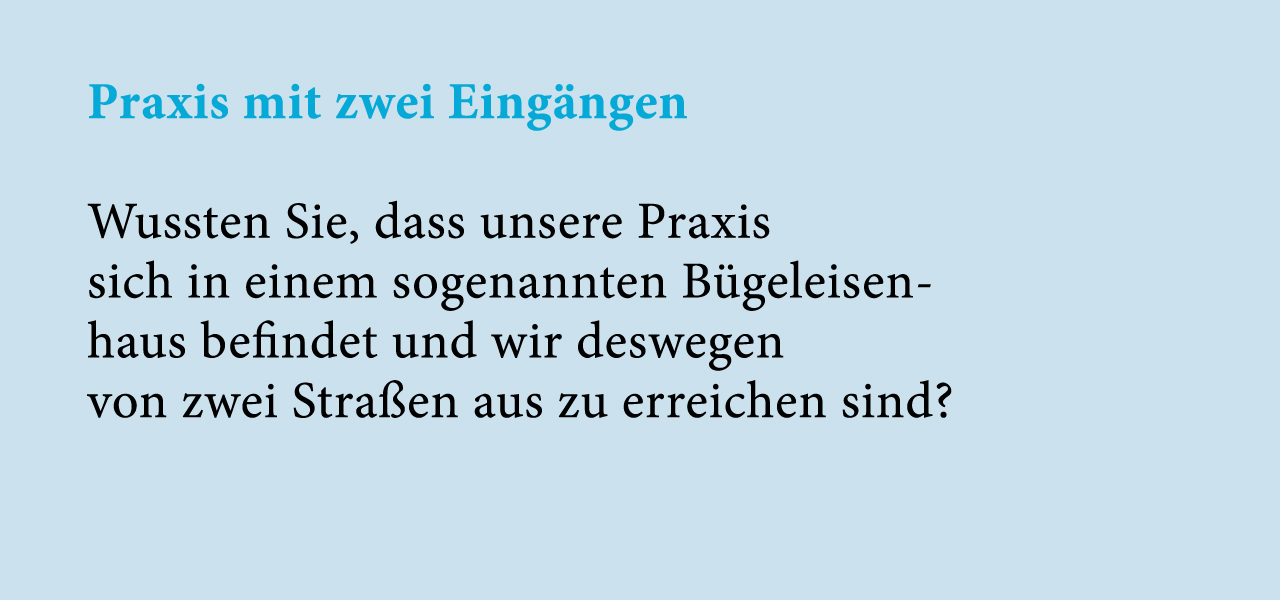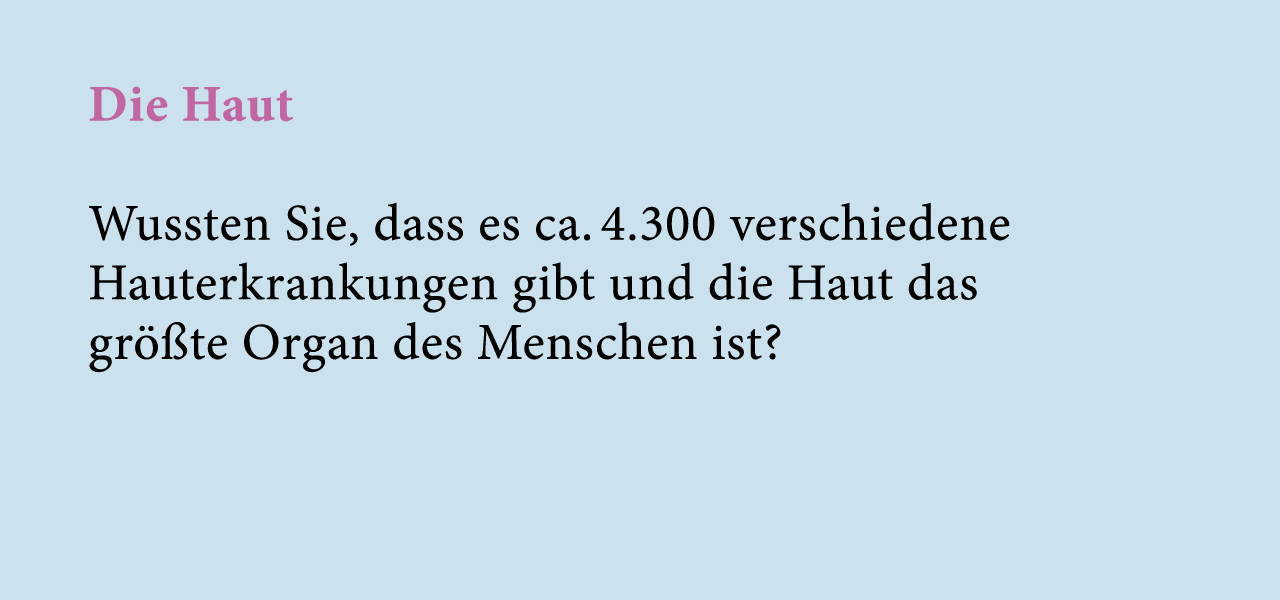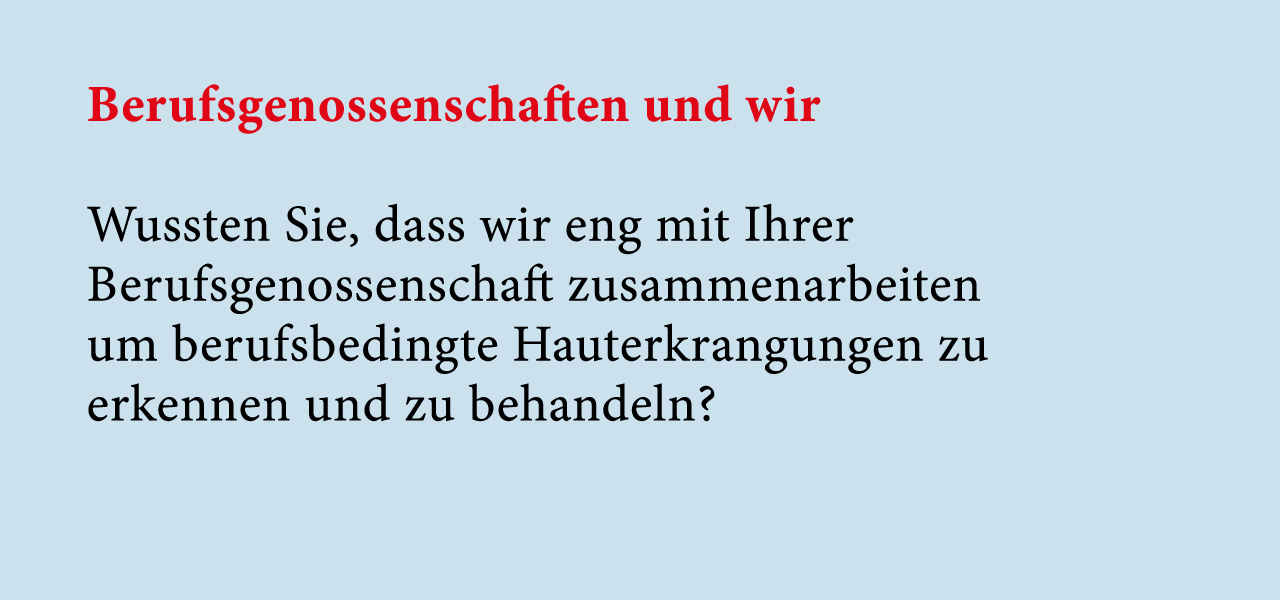Die Augengesundheit von Männern und Frauen ist nicht gleich. Unterschiede in der Anatomie und bei den Hormonen beeinflussen die Häufigkeit von Augenerkrankungen, auch reagieren Frauen oft empfindlicher auf Medikamente und Kontaktlinsen, zeigen jedoch bessere Behandlungsergebnisse. Welche Erkenntnisse vorliegen, wie sie sich auwirken könnten und warum weitere Forschung etwa mit künstlicher Intelligenz wichtig ist, erläutert Professor Dr. med. Maya Müller am 10. Oktober 2024 auf der hybriden Pressekonferenz beim Jahreskongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft e.V. (DOG).
Die Gendermedizin hat sich in den zurückliegenden Jahren als wichtiger Forschungszweig etabliert. „Auch in der Augenheilkunde gewinnt sie zunehmend an Bedeutung“, sagt Professor Dr. med. Maya Müller, Ärztliche Direktorin des Instituts für Refraktive und Ophthalmo-Chirurgie (IROC) in Zürich/Schweiz. „Für uns Augenärztinnen und Augenärzte ist es wichtig, Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu verstehen, um Behandlungsstrategien zu optimieren und die Patientensicherheit zu erhöhen“, fügt die DOG-Expertin hinzu, die auch Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Geschlechtsspezifische Medizin e.V. ist.
Frauen verlieren häufiger ihr Sehvermögen
So tragen Frauen in den USA ein um 15 Prozent höheres Risiko als Männer, an Erblindungen oder Sehbehinderungen zu leiden. Das belegen Daten der IRIS Registry, der weltgrößten Datenbank für Augenheilkunde.1 Frauen sind beispielsweise weltweit 2- bis 4-mal häufiger vom Engwinkelglaukom betroffen, einer Form des Grünen Stars.2 „Das liegt zum Teil an anatomischen Unterschieden, da Frauen oft kleinere Augen und engere Vorderkammerwinkel haben“, erläutert Müller. An einer endokrinen Orbitopathie leiden Frauen ebenfalls 4- bis 5-mal häufiger als Männer3 – einer Erkrankung, die sich durch stark hervortretende Augen bemerkbar macht. „Dies hängt mit der Tatsache zusammen, dass autoimmune Schilddrüsenerkrankungen wie Morbus Basedow bei Frauen viel häufiger auftreten“, so Müller.
Weibliche Hornhaut ist dünner und sensibler
Auch den Grauen Star entwickeln Frauen weltweit in vielen Regionen bis zu 1,7-mal häufiger, insbesondere nach der Menopause.4 „Hier könnte der Rückgang von Östrogen als Schutzfaktor gegen oxidativen Stress im Auge eine Rolle spielen“, erläutert die DOG-Expertin. Schließlich unterscheidet sich auch die Hornhaut, sie ist bei Frauen dünner und sensibler – was ebenfalls an den Hormonen liegen könnte, da Östrogen die Funktion der Nerven in der Hornhaut beeinflussen kann.5 „Die erhöhte Sensibilität führt möglicherweise zu einer größeren Neigung zu Augentrockenheit, einer typischen Augenerkrankung der Frau, und Unbehagen, das sich etwa beim Tragen von Kontaktlinsen bemerkbar macht“, betont Müller.
Geschlechterunterschiede bei Augentropfen
Hinzu kommen Geschlechterunterschiede bei der Wirksamkeit und Verträglichkeit von Therapien. „Wir wissen, dass Frauen häufig sensibler auf bestimmte Medikamente oder konservierende Zusatzstoffe in Augentropfen reagieren“, erklärt die Augenärztin. Andererseits schlagen Therapien oft besser an, weil Frauen ihre Behandlung konsequenter umsetzen. „Frauen wenden Glaukomtropfen regelmäßiger an und benötigen weniger Kontrolluntersuchungen bei der altersabhängigen Makuladegeneration“, erläutert Müller. Somit spielen auch psychosoziale Faktoren eine Rolle.
Genderspezifische Ansätze in Therapie und Prävention fehlen
Es sind also viele Aspekte, die geschlechterspezifische Unterschiede in der Ophthalmologie aufzeigen. Doch die Umsetzung dieser Erkenntnisse im klinischen Alltag gestaltet sich schwierig. „Viele Augenärztinnen und Augenärzte sind nicht ausreichend geschult, geschlechtsspezifische Faktoren einzubeziehen“, sagt Müller. Vor allem aber sei noch nicht genügend erforscht, was das konkret für Therapie und Prävention bedeutet.6 „Es fehlen detaillierte Langzeitstudien, die Unterschiede in Bezug auf Häufigkeit, Krankheitsverlauf und Therapieergebnisse analysieren“, kritisiert Müller. „Kurz: Es fehlen uns Richtlinien, die geschlechterspezifische Therapieansätze vorschlagen.“
Hoffnungen setzt die Augenärztin aus der Schweiz in Big Data und künstliche Intelligenz. „Sie ermöglichen präzisere Auswertungen“, meint Müller. Am Ende, so die DOG-Expertin, würden beide Geschlechter von einer optimierten, personalisierten Therapie profitieren.
Literatur:
1) IRIS Registry, Ophthalmology Times, 4 November 2023. Do women bear a greater burden for blindness and visual loss in the United States? Vgl. hier: AAO 2023: Do women bear a greater burden for blindness and vision loss in the United States? (ophthalmologytimes.com)
2) Tehrani, S. (2015). Gender difference in the pathophysiology and treatment of glaucoma. Current eye research, 40(2), 191-200.
3) Ponto, K. A., et al. (2013). Gender-Specific Aspects in Thyroid-Associated Orbitopathy. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 121(6), 320-325.
4) World Health Organization (WHO). Global Data on Visual Impairments 2010. Available from: https://www.who.int
5) Koskela, T., Manninen, J., & Laitinen, T. (2020). Gender and age-related differences in central corneal thickness. Journal of Cataract and Refractive Surgery
6) Suggested Principles for Sex and Gender Data in Ophthalmology Clinical Trials, JAMA Ophthalmol. 2024;142(2):131-132. doi:10.1001/jamaophthalmol.2023.6281 IRIS Registry, Ophthalmology News, 3 November 2023.